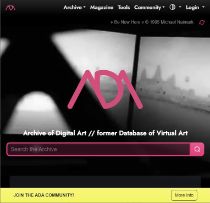FORSCHUNG
Seit 2002 verstehen sich die Bildwissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems als transdisziplinäre Antwort insbesondere auf die digitale Bilderflut unserer Zeit, die Transformationsprozesse in Kultur, Wissenschaft und politischer Ikonographie analysieren. Das Zentrum für Bildwissenschaften setzt sich in der Forschung mit Bilderwelten der digitalen Gegenwart und der Vergangenheit in engem Austausch mit Kulturinstitutionen sowie nationalen und internationalen Wissenschaftler_innen und Künstler_innen auseinander.
Mit Online-Bild- und Videoarchiven sowie neuen Analyseverfahren werden insbesondere die bildbezogenen Digital Humanities weiterentwickelt. Sehr eng wird dafür mit Künstler_innen sowie Museen, Archiven und weiteren Kulturinstitutionen zusammengearbeitet. Neben globalen Themen wird auch die österreichische Kunst- und Bildgeschichte berücksichtigt.
.2024-07-03-11-12-45.jpg) Serendipity tool (research: Alexander Wöran, programming: Fabian Schober).
Serendipity tool (research: Alexander Wöran, programming: Fabian Schober).
Bildbezogene Digital Humanities
Bisherige Forschungsprojekte im Bereich bildbezogener Digital Humanities haben sich z. B. auf den Ausbau eines Medienkunstarchivs zu einer umfänglichen Lehr- und Forschungsplattform konzentriert. In diesem Zusammenhang wurden innovative Datenvisualisierungen sowie Open-Source-Bildanalysetools entwickelt.
Eine Übersicht aller am Zentrum für Bildwissenschaften durchgeführten Forschungsprojekte finden Sie hier: ZBW-PROJEKTE
Eine Liste der aus der Forschungsarbeit am Zentrum für Bildwissenschaften hervorgegangenen Publikationen ist hier zu finden: ZBW-PUBLIKATIONEN
Aktuelle Schwerpunkte
Ein aktueller Arbeitsschwerpunkt liegt z. B. auf dem österreichischen Künstler Herwig Zens, zu dem eine digitale Gesamtedition des radierten Tagebuchs in Vorbereitung ist. 2023 entstanden in Verbindung mit den Vorarbeiten dazu u. a. mehrere avancierte Datenvisualisierungen in Zusammenarbeit mit Kolleg_innen - u. a. Florian Windhager, Johannes Liem und Eva Mayr – am Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, mit den Landessammlungen Niederösterreich sowie der Wiener Firma mindfactor (Michael Smuc, siehe https://dataquaria.com/zens, https://intavia.eu/2023/10/27/herwig-zens-biography/). Darüber hinaus sind weitere Projekte zu anderen Themen in Vorbereitung. Falls Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben, kontaktieren Sie uns gern: ZBW@donau-uni.ac.at
.2024-02-27-15-26-58.jpg)
Online-Archive und Tools am ZBW
Als Ressourcen für die Forschung und Lehre stehen folgende vom ZBW mit Kooperationspartnern in Forschungsprojekten aufgebaute Archive zur Verfügung:
Forschungsgeleitete Lehre
Aus der Forschungsarbeit geht ein renommiertes langjähriges, aktuell gehaltenes Lehrangebot hervor – zum Beispiel „Media Arts Cultures“ (seit 2015), „Crossmediale Ausstellungsentwicklung“ (seit 2006) sowie „Digitales Sammlungswesen“ (seit 2002). Letzteres bildet auch die Basis für Summer Schools 2023 und 2024 in Kooperation mit der Österreichischen Galerie Belvedere (www.digitalmuseum.at). Regelmäßig werden zudem Konferenzen und Vorträge veranstaltet sowie weitere Präsentationen wie z. B. beim Ars Electronica Festival, dem Festival „OFF Bratislava“, der IEEE VISAP oder in der Landesgalerie Niederösterreich erarbeitet.