-
Abschluss
Doctor of Philosophy - PhD
-
ECTS-Punkte
180
-
Format
-
Dauer
6 Semester
-
Zulassungsvoraussetzungen
Diplom- oder Masterstudium
-
Sprache
Englisch
-
Studienort
Krems (AT)
-
Verordnung (Curriculum)


Verfahren und Therapien der Regenerativen Medizin stellen ein Zukunftsfeld dar, auch bei bislang nur schwierig oder nicht zu behandelnden Krankheiten.
Univ.-Prof. Dr.
Michael Bernhard Fischer
PhD-Koordinator
Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

Elisabeth Hintermayer
Organisationsassistentin
Oder nehmen Sie gleich direkt Kontakt auf.
Profitieren Sie von unserem PhD-Studium
Das PhD-Studium "Regenerative Medizin" verbindet exzellente Forschung in unterschiedlichen Bereichen der Regeneration von Geweben und Organen mit einem innovativen Studienplan. Als „Early Stage Researchers“ forschen unsere Studierenden an Themen wie Entzündung und Gewebeschädigung und den daraus resultierenden regenerativen Mechanismen.
Die Studierenden sind im Rahmen von drittmittelgeförderten Forschungsprojekten tätig und werden auf ihrem wissenschaftlichen Weg von etablierten Forscher_innen begleitet und unterstützt. Unser Ziel ist es, Studierende auf forschungsbasierte Positionen sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie optimal vorzubereiten.
Akkreditierung
2015 hat die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria) die ersten beiden PhD-Studien der Universität für Weiterbildung Krems akkreditiert: „Migration Studies" und „Regenerative Medizin". Damit ist die Universität für Weiterbildung Krems eine der ersten öffentlichen Universitäten in Österreich, die ihre PhD-Studien nach internationalen Standards akkreditieren ließ. Im Jahr 2021 wurde auch das PhD-Studium „Technology, Innovation, and Cohesive Societies" von der AQ Austria erfolgreich akkreditiert. Zuletzt erfolgte im Dezember 2023 die Akkreditierung des PhD-Studiums „Applied Evidence Synthesis in Health Research" durch die AQ-Austria.
Curriculum
Der innovative Studienplan des PhD-Studiums „Regenerative Medizin“ verbindet die Pflichtmodule mit Wahlaktivitäten und den Arbeiten am Forschungsprojekt.
Der Studienumfang beträgt 180 ECTS-Punkte. Die Lehrveranstaltungen umfassen 30 ECTS-Punkte; die Dissertation hat einen Umfang von 145 ECTS-Punkten, auf das Rigorosum entfallen 5 ECTS-Punkte. 1 ECTS-Punkt entspricht 25 Arbeitsstunden der Studierenden (gemäß UG § 51 (26)).
-
Inhalte
Wissenschaftliches Arbeiten und Gute Wissenschaftliche Praxis
Ethik in der Wissenschaft
Wissenschaftliches Präsentieren und Publizieren
Medizinische Biostatistik und Mathematik
Projektmanagement
Design Klinischer Studien
Translation: Von der Grundlage zur klinischen Anwendung
-
Inhalte
Zellbiologie
Molekularbiologie, Zellzyklus, Signaltransduktion
Biochemie
-
Inhalte
Prinzipien der Regenerativen Medizin
Prinzipien des Tissue Engineering
Biologie der Stammzellen und Zellbasierte Therapie
Entzündung und Sepsis
Angeborene und Erworbene Immunität
Flow Cytometry and Imaging (Mikroskopie, SEM, AFM, LSM u.a.)
Zellkulturmodelle in der Regenerativen Medizin und im Tissue Engineering
-
Inhalte
Biomaterialien: Übersicht und Chemie
Scaffolds
Polymere Materialien in der Blutreinigung
Blut-Material Interaktionen
-
Inhalte
Leber: Regeneration und Unterstützung
Degeneration und Regeneration des Nervensystems
Knorpelregeneration
Angewandte Zelltherapie
-
Inhalte
Journal Club
Dissertantinnen-/Dissertantenseminar
Dissertation
Am Beginn des Studiums steht die Dissertationsvereinbarung – eine Vereinbarung zwischen Bewerber_in und Erstbetreuer_in der Forschungsarbeit. In ihr werden die Zusammenarbeit am Projekt, sowie Ziele und Pläne festgehalten. Auch das Betreuungsteam wird benannt.
Das Betreuungsteam begleitet das Studium und ist unterstützend bei Durchführung und Auswertung des Dissertationsprojektes. Die Dissertant_innen-Seminare (siehe Modul 6) sind halbjährlich stattfindende Treffen mit den Betreuer_innen, in denen der inhaltliche Fortschritt der Arbeit beraten und evaluiert wird.
Das Thema der Dissertation hat in einem sinnvollen Zusammenhang mit dem Gebiet der Regenerativen Medizin, insbesondere mit folgenden Themenbereichen zu stehen:
- Methoden der Organunterstützung und der extrakorporalen Blutreinigung
- Pathophysiologie der Sepsis und Erforschung inflammatorischer Mechanismen
- Wechselwirkungen von Blut bzw. Gewebe und Biomaterialen
- Regeneration von Gelenksoberflächen (Knorpelzelltransplantation, Therapie mit Wachstumsfaktoren, Implantation mesenchymaler Stammzellen)
- Immunregulatorische Mechanismen der mesenchymalen Stammzellen
- Gewebe- und Organersatz/Regeneration durch Stammzellen
- Neurorehabilitation
- Geriatrische Rehabilitation und Pflegewissenschaft
Studierende & Projekte
Die Studierenden sind im Rahmen von drittmittelgeförderten Forschungsprojekten tätig.
PhD-Koordinator
Faculty
Kern-Faculty
Assoziierte Mitglieder der PhD-Faculty
Prof. (FH) Mag. Dr.
Christoph Wiesner
Department of Life Sciences, IMC Fachhochschule Krems
Priv. Doz. Dr.
Reinhard Klein
Department of Life Sciences, Institut Biotechnologie, IMC Fachhochschule Krems
Priv. Doz. Prof. (FH) Mag. Dr.
Andreas Eger
Institutsleitung Angewandte Bioanalytik und Wirkstoffentwicklung/ Department of Life Sciences, Forschungsinstitut Bioanalytics, IMC Fachhochschule Krems
Erweiterte Faculty

Prof. Dott. Ing.
Emanuele Gatti
Professor für Translation Biomedizinischer Innovationen, Gastprofessor
Univ.-Prof. Dr.
Michaela M. Pinter, MAS
Universitätsprofessorin für Neurorehabilitations-forschung
Downloads
Hier finden Sie weitere Informationen über das PhD-Studium.
Bewerbung
Die Zulassung zum PhD-Studium „Regenerative Medizin“ erfolgt in einem zweistufigen Prozess:
- Ausschreibung von drittmittelfinanzierten PhD-Stellen
- Auswahlverfahren durch die PhD-Kommission
PhD-Studierende sind in der Regel über Drittmittelstellen (FWF Richtsätze) auf Basis finanzierter Forschungsvorhaben angestellt. Die Auswahl der Studierenden durch die PhD-Kommission erfolgt auf Basis der Bewerbungsunterlagen und nach Präsentation des Dissertationsvorhabens.
Unterlagen für die Bewerbung sind:
- Lebenslauf
- Identitätsnachweis (Reisepass, Personalausweis)
- Reifeprüfungszeugnis
- Studienabschluss-, Diplom- oder Masterprüfungszeugnis
Nach der Erfüllung aller Voraussetzungen erfolgt die Zulassung zum Studium.
Tags


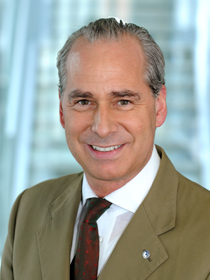

_Skokanitsch_Magnolia%20(210x280px).jpg)

_Skokanitsch.jpg)
.jpg)